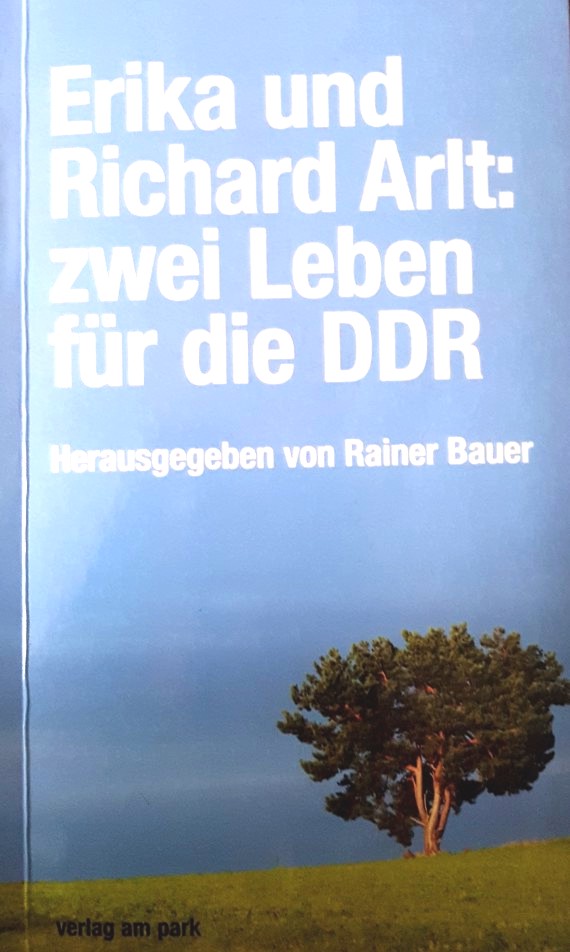
Das Leben von Erika und Richard Arlt ist ein Spiegel der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Die Rückseite:
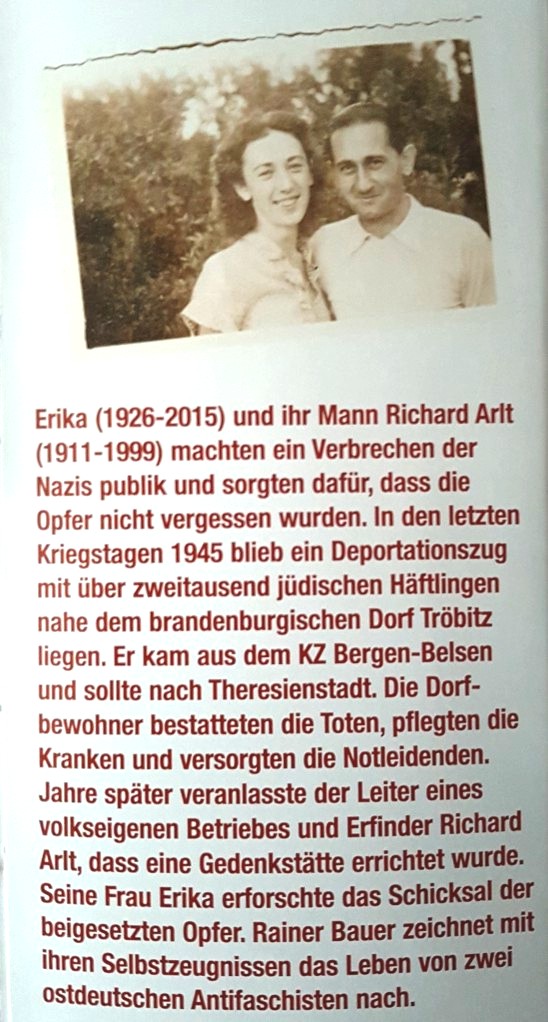
Dokumente zum Verlorenen Transport
Die Geschichte des Verlorenen Transports (Auszug aus Erika Arlt: Niemals Vergessen, S.6-7)
Als es auch für die faschistischen Machthaber
offenbar wurde, daß das Ende ihrer Herrschaft nicht mehr aufzuhalten
war und die letzten Stunden des "Dritten Reiches" angebrochen waren,
setzten sie den Plan der Vernichtung der in den Konzentrationslagern
und Zuchthäusern eingekerkerten Menschen in die Tat um. Himmler, der
Reichsführer der SS hatte angewiesen, kein Konzentrationslager und
"keinen Häftling lebend" in die Hände des Feindes fallen zu lassen.
Die SS verlud die Häftlinge der Konzentrationslager in Waggons oder
schickte sie auf Todesmärsche, um sie in eigens dafür eingerichteten
Vernichtungslagern oder Todesschiffen umzubringen. Mit dem Mord an
ihren Opfern wollten die Naziverbrecher die Zeugen ihrer Bluttaten
beseitigen.
Als sich britische Truppen der alliierten Armeen
dem Konzentrationslager Bergen-Belsen im Landkreis Celle in der
Lüneburger Heide näherten, wurden auch die Häftlinge aus
Bergen-Belsen "evakuiert", das heißt, in Waggons verladen, um in den
Gaskammern anderer Konzentrationslager umgebracht zu werden.
In Ausführung der Anweisung Himmlers wurden diese
unglücklichen Menschen von den SS-Schergen wie Vieh in die Waggons
gepreßt. Das Ankunftsziel sollte das in Böhmen gelegene
Konzentrationslager Theresienstadt sein.
Nach einem Bericht
Werner Weinbergs, geb.
1915, wohnhaft USA, eines Überlebenden des Transportes, wurden
Anfang April 1945 insgesamt drei Züge, beladen mit Gefangenen des
Konzentrationslagers Bergen-Belsen , abtransportiert.
Am 6. und 7. April 1945 verließen zwei Züge das
Lager. Der letzte Transport wurde am 9. April 1945 zusammengestellt.
Etwa 2.500 Häftlinge, meist jüdischer Herkunft, waren auf engstem
Raum zusammengepfercht, um in den Tod geschickt zu werden.
Am ersten und zweiten Tag blieb der Zug an der
Laderampe stehen, dann wurden die Türen geschlossen und von außen
verriegelt. Nach Mitternacht des zweiten Tages begann der Zug, sich
langsam vorwärts zu bewegen.
Am dritten Tag, dem 11. April, stand der Zug
außerhalb einer kleinen Stadt - Soltau - nur 25 Kilometer von
Bergen-Belsen entfernt.
Am 6. Tag nach Verlassen des Lagers, dem 15. April,
war der Zug bis Lüneburg gekommen, hatte also gerade 75 Kilometer
zurückgelegt.
Danach überquerte der Zug bei Lauenburg, ungefähr
40 Kilometer südlich von Hamburg, die Elbe. Weiter ging es in
Richtung Berlin. [Am 16.4. hielt der Zug bei
Wittenberge und geriet in einen Luftangriff, dem zahlreiche Insassen
zum Opfer fielen] Berlin zu durchqueren dauerte volle zwei
Tage.
Der Zug bewegte sich südwärts weiter über Luckenwalde, Lübben und Lübbenau. Der Zug fuhr sehr langsam und stand oft für längere Zeit. [am 17. oder 18. April erreichte er Schipkau bei Senftenberg, wo er 2 Tage nicht weiterkam]. Die ganze Zeit hatten diese unglücklichen Menschen ohne ausreichende Nahrung und unter katastrophalen sanitären und hygienischen Bedingungen im Zug verbracht und ein Ende der schrecklichen Fahrt war für die Insassen nicht abzusehen.
Während der Fahrt der Fleckfieber ausgebrochen und
viele Häftlinge verstarben daran, ebenso wie an Erschöpfung und
Unterernährung. Hielt der Zug, wurden die Türen durch die SS
geöffnet, die Toten ausgeladen und in der Nähe des Bahndammes
begraben.
Werner Weinberg schreibt
dazu:
"Das tägliche Begräbnis der Toten wurde immer
besser organisiert, es erhielt sogar etwas Würde. Wir wählten eine
passende Stelle in einer Wiese oder im Wald und schaufelten ein
Grab, dessen Größe von der jeweiligen Anzahl der Toten aus dem Zug
abhing. Die Toten wurden jetzt bekleidet begraben, während man im
Lager alle Kleidung weggenommen hatte, um sie für die Lebenden zu
gebrauchen. Das Zudecken des Grabes hing von der Zeit ab. Es konnte
geschehen, daß die Lokomotive pfiff, und wir zum Zug rennen mußten,
bevor wir unsere Aufgabe beendet hatten. Doch wenn genug Zeit da
war, sprach jemand ein Gebet."(1)
So ruhen entlang des Transportweges des dritten Zuges Tote verschiedener Nationalität. Namentlich erfaßt wurden 138 Tote.
Richard Bleiweiß, ein
weiterer Überlebender des Transportzuges, geb. 12.12.1906, wohnhaft
in Dresden, berichtet:
Unser Zug war der letzte, der
von Bergen-Belsen abging. Er war in letzter Minute zusammengestellt
worden, denn die alliierten Armeen waren im Vormarsch. Etwa 2.500
Frauen, Männer und Kinder wurden in Waggons zu 70 bis 80 Personen
zusammengepfercht. Alles starrte vor Schmutz. Unsere Nahrung bestand
aus roten Rüben und Kraut. Falls jemand versuchte, den Waggon zu
verlassen, wurde er geschlagen. Die erste Station war Soltau bei
Celle. Da kam der Werkmeister an unseren Zug. "Kameraden, Ihr seid
frei!" rief er. Aber die Engländer unternahmen nichts, um uns zu
befreien. Sie ließen den Zug weiterfahren. Auf einem anderen Bahnhof
kamen wir in einen starken Luftangriff, und ein Treffer ging in
unseren Zug. Es war wohl auf der 2. oder 3. Station hinter
Bergen-Belsen. Die Toten wurden aus dem Zug geworfen. Der Transport
ging weiter über Berlin nach Falkenberg/Elster. Hitlerjungen liefen
mit Maschinenpistolen herum. Dann fuhr der Zug nach Beutersitz. Der
Werkleiter vom BKW,
Rothkegel, ließ eine Lok
bringen, und wir wurden mit der Werkbahn von Beutersitz nach Tröbitz
gebracht.
Bereits am 20. April 1945 rollte durch Tröbitz ein fast
gespensterhaft wirkender Zug in Richtung Falkenberg. Weiße
Tücher flatterten an den Waggons. Da auf dem Bahnhof Falkenberg
die Eisenbahnbrücke bei einem Fliegerangriff durch Bomben
zerstört war, kam der Zug in dieser Richtung nicht weiter. So
stand er mit den Häftlingen fast drei Tage auf den
Reichsbahngleisen.
Auf dem linken Gleis stand der Zug aus Bergen-Belsen bei Langennaundorf am Bahnkilometer 101,6. Am Ende des Schienenstranges befindet sich die Brücke über die Schwarze Elster. Mit einer Lok des Anschlußgleises der Beutersitzer Kohlenwerke wurde er zum Bahnkilometer 106,7 in die Nähe der Brikettfabrik Wildgrube gebracht wurde. Diese Lok fuhr der Lokführer Paul Müller aus Beutersitz, der sich dazu bereit erklärte, was zu dieser Zeit nicht ganz ungefährlich war, da in Beutersitz und Umgebung Kampfhandlungen stattfanden. Wenn hier als Ortsangabe die Kilometersteine 101,6 und 106,7 der Deutschen Reichsbahn angegeben sind, so deshalb, weil an diesen Stellen Tote des Zuges ausgeladen und in Massengräbern beigesetzt wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Zug vor der Brücke über die Schwarze Elster zum Stehen kam und mit 60 Waggons und einer Länge von ca. 600 Meter fast bis an die Fernverkehrsstraße 101 reichte.Die Brücke über die Schwarze Elster bei Langennaundorf wurde am 21.04.1945 durch Angehörige der faschistischen Wehrmacht gesprengt.
23. April 1945 – Tag der Befreiung
Die Sowjetarmee setzte in den Tagen des Monats April 1945 ihren Vormarsch auf deutschem Boden beharrlich fort. Während der Brennpunkt der Kämpfe in den Berliner Stadtbezirken lag, näherten sich Truppenteile der 1. Ukrainischen Front auch unserem Kreisgebiet. Panzerfaust, Panzerschreck, Panzersperren, Volkssturm und Werwolf konnten den Sieg der sowjetischen Befreier nicht mehr verhindern.
Am 21. April 1945 wurden Finsterwalde und Doberlug-Kirchhain
durch die Soldaten und Offiziere der Roten Armee vom
Hitlerfaschismus befreit.
Am 23. April folgten weitere Städte und Gemeinden der näheren
Umgebung wie Bad Liebenwerda, Falkenberg, Übigau und Herzberg.
In der Gemeinde Tröbitz wurden die ersten sowjetischen Soldaten
von Bewohnern des Nordfeldes am Sonntagfrüh, dem 22. April 1945
gesehen.
Bis zum Sonntag, dem 22.04.1945, war in der Villa der Werhahns
ein Stab der faschistischen Wehrmacht untergebracht. Der
Industrielle Werhahn war Ende Januar 1945 in Tröbitz verstorben.
Die „gnädige Frau“, wie sich Frau Werhahn anreden ließ, hatte es
vorgezogen, sich in Richtung Westen abzusetzen. Am
22./23.04.1945 brannte die Villa der Werhahns. Es wurde
vermutet, daß sie von den abziehenden Offizieren der
faschistischen Wehrmacht in Brand gesteckt wurde, so daß
keinerlei Dokumente zurückblieben. Einige verantwortungsbewußte
und mutige Bürger aus Tröbitz sorgten dafür, daß die vorgesehene
Sprengung der Straßenbrücke in der Nähe der alten
Abraumwerkstatt (Straße nach Schönborn – Doberlug) verhindert
wurde.
Der 23. April 1945 war der Tag der Befreiung vom
Hitlerfaschismus für Tröbitz. Dieser Tag sollte eigentlich ein
Tag der Freude und neuer Hoffnung sein, da der braune Spuk nun
endlich vorbei war. Doch an diesem Tag wurde noch einmal das
ganze Ausmaß der faschistischen Barbarei offensichtlich. Als die
Soldaten der Roten Armee den Zug am 23. April 1945 fanden und
die Waggons öffneten, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens und
des Grauens. In vielen Waggons lagen zwischen den noch lebenden
Menschen Tote, die während der letzten Tage und Stunden
verstorben waren. Die Soldaten und Offiziere der Roten Armee
sahen sich tausenden ausgemergelter, hungriger und todkranker
Menschen gegenüber.
Eine Überlebende des Transportes, Judy Gross (verh. Morten), die
im Frühjahr 1945 gerade 13 Jahre alt war, schildert diesen
Augenblick: „Befreiung erschien uns in Form eines Russen auf
dem Pferd. Wir schrien alle zusammen, unser wunderbarer
russischer Befreier und seine Zugladung Juden, die beide
abküßten, ihn und das Pferd".
Für die etwa 2000 Überlebenden des Vernichtungstransportes tat
schnelle Hilfe not, um die halbverhungerten und kranken Menschen
zu retten und ihnen ein Leben in Freiheit zu sichern. Die
Soldaten und Offiziere der Roten Armee taten alles, um die Not
dieser unglücklichen Menschen zu lindern. Sie stellten
Verpflegung und Medikamente zur Verfügung und leisteten
ärztliche Hilfe, meist mit primitiven Mitteln. Unter den
ehemaligen KZ-Häftlingen befanden sich auch jüdische Ärzte, die
sich – soweit sie dazu in der Lage waren – sofort selbstlos zur
Pflege und Behandlung der erkrankten Menschen zur Verfügung
stellten.
Viele Tröbitzer Einwohner legten Hand an und halfen, den Zug zu
entladen. Die Verstorbenen wurden in unmittelbarer Nähe der
Gleisanlagen in zwei Massengräbern beerdigt (Wildgrube und
Blockstelle). Eine große Anzahl jüdischer Menschen wurde in den
Häusern und Baracken des Lagers Nordfeld (ehemalige
Kriegsgefangenenbaracken) untergebracht. Andere wohnten bei
Tröbitzer Familien. Mehrere junge Frauen und Mädchen sowie auch
Männer des Ortes Tröbitz pflegten die kranken Menschen und
kochten in einer großen Gemeinschaftsküche für sie das Essen.
Doch dann kamen angsterfüllte Tage und Wochen. Die schreckliche,
ansteckende Krankheit, das Fleckfiber, beherrschte den Ort
Tröbitz.
Mit großer Verantwortung und umsichtig wurden durch die
sowjetische Kommandantur Maßnahmen eingeleitet, damit die
gefährliche Krankheit sich nicht auf andere Ortschaften
ausweiten konnte. Ohne Genehmigung konnte niemand in den Ort
hinein und niemand heraus. Durch die tatkräftige Hilfe der
Soldaten der Roten Armee, der sowjetischen und jüdischen
Ärzte sowie des Sanitätspersonals konnte die Epidemie
gebannt werden. Trotzdem starben nach der Befreiung noch 320
Frauen, Männer und Kinder an dieser schweren Krankheit.
Keine noch so aufopferungsvolle Pflege und Hilfe konnte sie
retten. Die genaue Zahl der Verstorbenen läßt sich nicht
mehr feststellen, da von den im Nordfeld Verstorbenen keine
vollständigen Totenlisten vorliegen.
Abschrift eines Protokolls vom 2. Februar 1946
P r o t o k o l l
------------------
Am 24. April 1945 in der Nähe von Tröbitz wurde der
Ausländertransport von 2500 Personen befreit von der
Roten Armee und von diesen Transport sind hier 320
Personen verstorben an Fleckfieber und Erschöpfung.
Dieses Protokoll bestätigen:
Der Bürgermeister,
Kühne
Wachtmeister,
Schimpfkäse
USA.Staatsangehöriger,
Bleiweiss
Tröbitz, den 2. Februar 1946.
Es ist eine große Tragik. Diese unglücklichen Menschen
warteten sehnsüchtig auf den Tag ihrer Befreiung. Sie wurden
befreit. Sie hofften, nun endlich in Freiheit und
menschenwürdig leben zu können – und mußten dennoch sterben.
Doch auch Tröbitzer Bürger infizierten sich mit Fleckfieber.
26 verstarben nach den Tagen der Befreiung vom
Hitlerfaschismus an dieser schrecklichen Krankheit. Meist
waren sie bei der Pflege der Kranken eingesetzt. Bisher
wurde immer die Zahl 46 genannt, die durch Fleckfieber
verstarben. Nachforschungen ergaben, daß am 23. und 24.
April 1945 18 Tröbitzer Bürger, die namentlich bekannt sind,
umkamen. Als Todesursachen sind vermerkt: Freitod durch
Öffnen der Pulsadern, Erhängen, Ertrinken, Erschießen sowie
Tod durch Kriegseinwirkungen und 2 normale Todesursachen.
Tröbitz Nordfeld und der Werhahn-Konzern
Die Landschaft von Tröbitz und der Nachbargemeinden Domsdorf
und Wildgrube ist vom Braunkohlenbergbau geprägt. Um 1900
begann die Gewinnung der Braunkohle aus Tief- und Tagebauen.
In dieser Zeit wurde auch die Grube "Hansa" in Tröbitz
eröffnet und der Ort entwickelte sich zu einer
Industriegemeinde. 1968, nach der Auskohlung der Tagebaue,
wurde der Betrieb umprofiliert und war bis 1990 Bestandteil
des Kombinates Landmaschinen. Die Grube "Hansa" gehörte zum
Werhahn-Konzern. Die Familie Werhahn ist verwandt und
verschwägert mit dem früheren Bundeskanzler der BRD, Konrad
Adenauer. Der Werhahn-Konzern existiert noch heute als
weitverzweigtes Unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland.
Der totale Zusammenbruch des faschistischen Staates im Mai
1945 hinterließ nicht nur materielle Schäden größten
Ausmaßes. Über sechs Jahre dauerte der von den
Hitlerfaschisten angezettelte zweite Weltkrieg. Die
deutschen Imperialisten und Militaristen hatten in ihrer
Profitgier nach einer Neuaufteilung der Welt Millionen
Menschen auf den Schlachtfeldern verbluten lassen. Millionen
Männer, Frauen, Kinder und Greise wurden in den
Konzentrationslagern gequält und ermordet. In die Millionen
ging auch die Zahl der Menschen, die aus den von der
faschistischen Wehrmacht überfallenen Ländern Europas nach
Deutschland verschleppt und als Arbeitssklaven ausgebeutet
wurden. Für die kapitalistischen Unternehmen war es
selbstverständlich, daß sie zur Erhöhung ihres Profites auf
die Gefangenen der überfallenen Länder zurückgriffen.
Auch der Werhahn-Konzern in Tröbitz bereicherte sich durch
die Ausbeutung der Arbeitskraft der verschleppten Menschen.
Bei primitiver Unterkunft und schlechter Ernährung wurden
die Gefangenen zu körperlich schwerer Arbeit in der Grube
"Hansa" eingesetzt. Die Entlohnung der Gefangenen und
Zwangsarbeiter war an keine gesetzliche Regelung gebunden
und eine zusätzliche Gewinnquelle für den Konzern.
Im Nordfeld, ca. 2,5 km vom Ort entfernt, waren die
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter untergebracht.

Wohnbaracke im Lager Nordfeld
Als "Nordfeld" wurde eine Schachtanlage der Grube "Hansa"
bezeichnet, die zu den Senftenberger Kohlenwerken gehörte
und dem Werhahn-Konzern unterstand. In dieser Schachtanlage
wurde die Kohle bis Anfang der 20er Jahre im Tiefbau
gewonnen. Mit dem Aufschluß des Ostfeldes, das an das
Nordfeld unmittelbar angrenzte, kam 1927 eine Förderbrücke
zum Einsatz und die Schachtanlage wurde stillgelegt. An
Gebäuden befand sich dort lediglich eine niedrige
Steinbaracke, die als Maschinenhaus und Aufenthaltsraum für
die Belegschaft diente.
Nach dem Überfall der deutschen Faschisten auf Polen im
September 1939 wurde zur Unterbringung polnischer
Kriegsgefangener im Nordfeld zunächst eine Wohnbaracke
eingerichtet. Später, als immer mehr Gefangene ins Lager
kamen, wurden noch 3 Holzbaracken und 2 Steinhäuser zur
Unterbringung der Gefangenen und des Wachpersonals gebaut.
Eine große Holzbaracke diente halb als Wohnbaracke und halb
als Gemeinschaftsraum mit anschließender Küche und
Essenausgabe.
(1) Werner Weinberg "Wunden, die nicht heilen dürfen"
(2) Liebenwerdaer Kreiszeitung Nr. 11 vom 18.03.1965
Seite 4
(3)
Gedenkstätten der Arbeiterbewegung in den Kreisen
Finsterwalde - Luckau - Calau und Lübben